| Performancesfilme
Malperformance
Musikauftritte
Diashows
Dichterzusammen
|
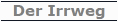 Rauminstallation im Alten Stadtsaal in Speyer im November 2000. Ein monumentales, schwarzes, ungegenständliches Gemälde, aufgezogen auf schwarzen Stoff, versperrt die Sicht in den Alten Stadtsaal. Martin Eckrich empfängt die Besucher nicht besonders einladend. Doch der erste Eindruck täuscht. Wagt man sich an weiteren gehängten Tüchern vorbei, steht man plötzlich mitten in der Installation auf einem mit weißem neuen Nesseltuch ausgelegten Weg, der verschiedene kleinere Installationen als Stationen miteinander verbindet.
Mit dieser Arbeit schuf der Künstler seinen bisher größten Kultraum. Raumfüllend dehnt sich das begehbare Kunstwerk bis auf die Bühne aus. Die höchste Station, der „Musikturm" reicht bis in die Ebene der Kronleuchter hoch. An den Wänden arrangierte Eckrich großformatige Gemälde und Objektbilder zu verschiedenen Werkgruppen. Für Struktur sorgen der Weg selbst, und seine Wegweiser - verschiedene Symbole wie Dreiecks- oder Kreisbilder, die „den Geist auf dem rechten Weg halten sollen". Zusätzlich wachen große Figuren wie Mahnmale über dem Geschehen. Diese heben ihre Arme und Hände aus verzweigten Ästen wie ein schützendes Dach segnend über den Weg.
Zwei Stationen bilden inhaltlich das Zentrum in dieser Kunstlandschaft. Eine Sackgasse, ein dunkler Weg, der eigentliche „Irrweg" führt zu einem Spielzeugmodell des Konzentrationslagers Dachau. Gegensatz und Erlösung bildet ein weißes Iglu auf der Bühne des Saales - das Haus für die Seelen „der" Juden. Die Spannung, die sich im Verlauf aller Stationen aufbaut, löst sich erst auf der Bühne auf.
Der schwarze Gang, mit in Blut getränktem Nesseltuch am Boden, führt zu dem Modell des Konzentrationslagers, welches als makabres Spiel gedacht und gebaut wurde. Integriert in eine Eisenbahnlandschaft verharmlost es eine Tragödie, auf die Eckrich durch den Einbau in seine Installation mit rücksichtsloser Direktheit verweist. Die Herkunft des Fundstückes bleibt im Ungewissen, bekannt ist lediglich der Fundort, ein Feld bei Speyer. Schützende große Schirme können ihre Funktion nicht erfüllen. Sie sind zerrissen, einer umgestülpt und mit schwarzer Friedhofserde gefüllt. Der schützende wärmende Mantel - ein Objektbild am Eingang des Raumes - ist zu weit weg um zu helfen. Der Hochsitz daneben, aufgestellt um sich einen Überblick zu verschaffen, erscheint vor diesem Hintergrund jedoch wie ein bedrohlicher Wachturm.
Ein mit Alufolie umhüllter Blitz verweist von der Tragödie direkt auf die Bühne: Das Iglu bildet, sowohl inhaltlich als auch in der künstlerischen Ausführung, einen Gegenpol. Künstlich und fast nicht greifbar erscheint es durch das helle Neonlicht, welches durch die durchbrochenen Wände dringt. Das Baumaterial, weiße zerschnittene Schallschutzplatten, steht konträr zu den morbiden Fundstücken mit ihrer erdigen Farbigkeit, wie sie Eckrich üblicherweise verwendet. Im Innenraum dieses kleinen Tempels, dieser sakralen Höhle, bilden drei Neonröhren ein Zelt über einem Spiegel, auf dem ein Glasgefäß mit Wasser aus der mittelalterlichen Speyerer Mikwe steht.
Eckrich baut ein Haus für die Seelen „der" Juden. Sie sollen in dieser klaren, hellen Umgebung wohnen. Damit folgt er unbewußt Vorstellungen des im frühen 10. Jahrhunderts wirkenden Religionsphilosophen Sa'adja, für den die Seele eine lichtartige Substanz war, die an Reinheit noch über der Distanz der Himmelsphären stand. Die Helligkeit und Reinheit ist überdeutlich und läßt Mißtrauen aufkommen. Die verwendeten Dämmplatten sollen gegen den Lärm, gegen den chaotischen Geräuschpegel und gegen die Reizüberflutung abschirmen.
Eckrich zeigt in dieser Installation Skulpturen und Gemälde integriert mit Fundstücken zu einem Gesamtkomplex. Mit akustischen Reizen verschaffen sich verschiedene Stationen Aufmerksamkeit. Noch funktionstüchtige Fundstücke sorgen für Radau. Eine Waschmaschine rotiert, in einer Riesenbackschüssel plätschert ein Springbrunnen, Ventilatoren brummen und Staubsauger und Fernseher werden in neuer, vermeintlich sinnloser Funktion eingesetzt. „Schöner" klingt's im Musikturm, wo kleine Rotationsmotoren mit Drähten versehen sind und Gitarrensaiten anschlagen. Dort kann der Besucher mit einem Schalter ein Radio anschalten.
Ebenso überträgt Eckrich die Verantwortung für den Einsatz der Staubsauger und Ventilatoren dem Besucher. Diese Geräte bilden zusammen mit einer Folie, die sich mit der bewegten Luft wie Wellen bewegt, ein Gespann am Sonnenwagen des Zeus. Mit ihm versucht eine alte Religion bei uns zu landen, doch es sieht nach einer Bruchlandung aus. Der Fernseher grieselt und soll mit diesem gleichtönenden Geräuschpegel an Wasserrauschen erinnern. Der alte Holzwagen, halb zerbrochen, kommt nicht vorwärts, obwohl er unterstützt wird durch einen Unterbau unzähliger Autoreifen und einer Waschmaschine, deren Trommel sich wie eine Schiffsschraube abmüht. Dennoch, Zeus - mit eindeutig weiblichen Attributen - läßt sich nicht beirren. Zufrieden und hoffnungsvoll schaut er mit seinem Goldfolienhut, der mit Lämpchen beleuchtet wird, auf den Musikturm. Den Gitarrenklängen kann man sich nicht entziehen. Musik befreit von den aufgebauten Spannungen und gilt als Hoffnungsträger.
Eckrichs Kulträume verweisen nie nur auf eine bestimmte Religion. Der Künstler setzt vielfältige Zitate aus der griechischen Mythologie, aus Weltreligionen und aus der Geschichte ein. Aber er vermengt sie nicht wahllos, so entsteht auch nie eine pathetische Aufgesetztheit, er meistert diese Gratwanderungen und kommt nie vom richtigen Weg ab. Auch nicht beim „Irrweg" zwischen Rindenmulch und Blättern. Mit dieser „natürlichen" Gestaltung des Bodens, setzt er einen Gegenpunkt zur Technik, die meistens nicht mehr funktioniert - also auch nicht die Lösung sein kann. Die gestreuten Blätter lassen den Eindruck eines Parks aufkommen, einer phantastischen Landschaft. Doch die Illusion einer Freizeitgestaltung ist mehr als trügerisch. Entpuppen sich die Stationen doch als Verweise auf grausame und beängstigende Situationen. Assoziationen an Kreuzwege und Prozessionen kommen auf. Halt gibt Eckrich mit christlicher Symbolik. Mit Dreiecksformen verweist er auf die Dreifaltigkeit. Am Wegrand stehen nicht nur segnende Figuren, man stolpert über getrocknete Tierleichen, zum Beispiel einen Vogel, der sich mit einem Igel verbissen hat, gemeinsam wurden sie während des Kampfes von einem Zug überfahren. Mit rücksichtsloser Direktheit spricht Eckrich von Grausamkeit und Tod und kritisiert in diesem Fall gleichzeitig Errungenschaften der Technik. Leben impliziert immer auch Sterben. Eckrich sieht es ganzheitlich von der Geburt bis zum Tod, und er verweist religiös spielerisch noch darüber hinaus. Humorvolle Komponenten stimmen versöhnlich und sind tatsächlich hoffnungsvoll gemeint. Doch das Lachen ist nie laut und oftmals auch hilflos verzweifelt.
Die ganzheitliche Sicht des Lebens zeigt sich nicht nur in der Einheit des Stationsweges, sondern auch in seinem künstlerischen Mikrokosmos. Der besteht aus einer Vielzahl von verarbeiteten Fundstücken. Diese sind auch verantwortlich für Martin Eckrichs typische „Schmutzästhetik". Fundstücke sind für ihn erst interessant, wenn ihnen schon die Farbe abblättert, wenn sie bereits Geschichte in sich aufgesogen und damit sichtbar tragen. Die inzwischen schon ziemlich abgegriffene Bezeichnung „Spurensicherung" paßt nur bedingt auf seine Arbeiten, da er mit diesen Spuren nicht nur auf Ursprüngliches verweist, sondern weit darüber hinausgeht. Alt ist nicht gleich wertvoll. Mit schäbigen, eigentlich unbrauchbaren Fragmenten unterstreicht er diese Aussage. Das Wertvolle sind die Geschichten, die er mit diesen unterschiedlichen kaputten Gegenständen erzählt. Verfremdet werden sie durch neue Kompositionen in oft unsinnigem Zusammenhang. Mit der Herstellung neuer Gegenstände aus Ton, die beispielsweise stellvertretend für archäologische Fundstücke stehen, löst er sich deutlich von einer romantisierenden Aura des Alten und Morbiden. Nur noch die Idee, der Inhalt hat Bestand. Es findet eine Entmaterialisierung statt, und diesen Zustand erreicht er mit einer genialen Einsetzung von Materialien.
In einer Station fällt zuerst ein spielerisches Moment ins Auge. Doch es geht um das Sterben und um den Tod. Setzkästen und Schubladen geben ihren Inhalt preis. Wie kleine Särge muten diese Holzobjekte an, die in dieser Katakombe aufbewahrt werden. Ein großer Sarg steht aufgebrochen und gibt den Blick frei auf Erinnerungen, die liebevoll in den Schubladen aufbewahrt wurden. Persönliche Gegenstände, wie Brillen oder Notizzettel sind in Objektkästen über- und nebeneinander gestapelt. Sie fungieren wie Grabbeigaben und stehen stellvertretend für den Menschen, der sie besessen hat Die Erinnerung gilt dieser Person. Scherben unterstreichen die Endgültigkeit der Situation. Christus am Kreuz als Erlöser taucht auf der Rückseite einer Kiste auf. Kleine Installationen oder kleine Köpfe aus Ton und besonders ein tönerner kleiner Leichnam innerhalb dieses Raumes im Raum vermitteln durch ihre Allgemeingültigkeit eine Distanz zur personifizierten Trauer. Mit ihrer Allgemeingültigkeit treffen sie jedoch jeden.
Martin Eckrich läßt uns tief in seine Seele schauen, er präsentiert eine grenzenlose Offenheit. Bestes Beispiel ist sein Familienalbum, welches er auf einem Pult ausgelegt hat und in dem Stationen seines Lebens zu sehen sind, angefangen bei seiner Taufe, in den Armen seines Paten liegend.
Eckrichs persönliche Wahrnehmung, seine eigene Erfahrungswelt vermittelt er in dieser Installation mit einer Überfülle an Ideen, die er mit einer enormen kreativen Kraft konkretisiert. Die bei diesem Prozeß freigewordene Energie schwebt spannungsreich im Raum. Er bahnt einen Weg im „Chaos göttlicher Ordnung" wie er es nennt.
Beate Steigner-Kukatzki
Auszug aus dem Katalog "Martin Eckrich - Kulträume" von Herbert Dellwing. Herausgegeben vom Kunstverein Speyer im Jahr 2000. Verlag: Bild & Kunst, Harthausen |
| |

